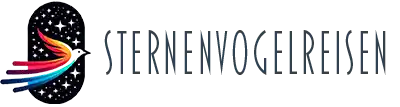Erinnerst du dich noch an die Wohlfühlwörter, die besonderen Schönheiten der deutschen Sprache? Hier sind sie noch mal, und zwar in freier Wildbahn, wenn man so sagen darf. Die schönsten Wörter in klassischen Zitaten.
Ein bisschen gestrig, ein wenig rückwärtsgewandt, und sehr traditionell. Und? Das darf man sich schon gönnen. Die verwendeten Begriffe stammen allesamt aus der Liste: 99 Wohlfühlwörter — Die schönsten Wörter der deutschen Sprache, dort findest du alles in der Übersicht. Siehe auch:
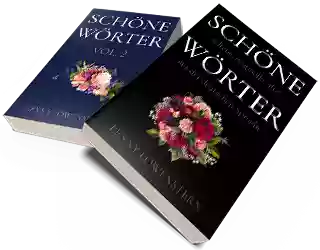 Eine Bibliothek der schönen Wörter ... Ja, es gibt sie noch, die schönen Wörter. Begriffe mit dem besonderen Klang. Wörter, die Sehnsüchte und Erinnerungen in uns hervorrufen. Die Welt von damals, sie ist noch vorhanden. Erinnerungen an Altes und längst Vergessenes. Was verloren ging, ging nie ganz, die Sprache bewahrt es für uns. Hier ist eine wunderfrohe Blütenlese in Buchform mit den schönsten Wörtern der deutschen Sprache. Jetzt ansehen
Eine Bibliothek der schönen Wörter ... Ja, es gibt sie noch, die schönen Wörter. Begriffe mit dem besonderen Klang. Wörter, die Sehnsüchte und Erinnerungen in uns hervorrufen. Die Welt von damals, sie ist noch vorhanden. Erinnerungen an Altes und längst Vergessenes. Was verloren ging, ging nie ganz, die Sprache bewahrt es für uns. Hier ist eine wunderfrohe Blütenlese in Buchform mit den schönsten Wörtern der deutschen Sprache. Jetzt ansehen- Die schönsten Liebeswörter in klassischen Texten
- 30 herzaufwühlende Zitate aus der Literatur
- 20 farbenfrohe Zitate aus der klassischen Literatur
Wohlfühlwörter, so hat man sie einst benutzt
Eine leichte Röte der Verlegenheit darüber, daß man seinen geheimen Wunsch erriet, färbte das Antlitz des jungen Mannes.
Elisabeth Bürstenbinder (Werner): Gesprengte Fessel, 1875.
Sie blickt geradeaus, ein Tuch ist ihr über das Haar gelegt und fällt zu beiden Seiten auf Hals und Schultern anschmiegsam herab. In ihrem Antlitz, ihren Blicken hegt sie eine wunderbare Hoheit, einen königlichen Ernst, als fühle sie die tausend frommen Blicke des Volkes, das zum Altare zu ihr aufsieht.
Herman Grimm: Das Leben Michelangelos, 1860.
Nun fing die gute Elsbette an, zu backen und zu rühren, und dachte, es könne ihr nicht fehlen. Sie brachte eine Schüssel dampfender Krautklöße auf den ersten Mittagstisch – wirklich ein einziger Duft und Augenschmaus! – ein Bild für einen Maler! Und süße, lockere Heißwecken mit purpurrotem Hagebuttenguß gab es am nächsten Tag.
Frida Schanz: Der flammende Baum, 1916.
O ihr Sternenaugen
O ihr Sternenaugen,
Oder Augensterne!
Könnt’ ihr aus der Ferne
Diese Tränen saugen,
Die ich um euch wein’ und weine gerne,O ihr Augensterne,
Oder Sternenaugen!
Wozu könnten taugen
Euerm lichten Kerne
Diese trübem Gram entpreßten Laugen?O ihr Sternenaugen,
Oder Augensterne!
Wollt ihr dennoch gerne
Diese Tränen saugen,
Die ich zu euch wein’ in jene Ferne?
Friedrich Rückert: Kindertodtenlieder, 1872.
Eine gewisse Ahnung wollte mich an den Sitz fest schrauben. Sie wissen aber, daß ein Student am Nachmittag im schönen Wetter keinen eigenen Willen hat. So ließ ich mich fortschleppen. Heimlich lechzte ich freilich nach einer Augenweide, denn ich hatte mich viele Monden lang vor allem Schönen standhaft verschlossen.
Paul Heyse: Der Kreisrichter, 1855.
»Menschenskind, da bist du ja ein Backfisch!« – »Ich???« – – »Natürlich, mit vierzehn Jahr, sieben Wochen, sieben Tage, sieben Stunden bist du ein Backfisch! Mädchen, bist du dir einmal klar geworden, was das ist?« – – »Pah, Fritz Haffner meint: Es war’ nicht Fleisch, nicht Fisch. – Nicht Windbeutel und nicht Schlagsahne!«
Ernst Georgy: Die Berliner Range – Neue Bekenntnisse, 1900.
Da flohen die Knaben hinter das Meßpult oder kletterten auf den Sitz des Vorsängers. Andre verkrochen sich in den Beichtstuhl. Aber der Pfarrer teilte behend rechts und links einen Hagel von Backpfeifen aus; einen der Jungen packte er am Rockkragen, hob ihn in die Luft und duckte ihn dann in die Knie, als ob er ihn mit aller Gewalt in die Steinfliese hineindrücken wollte.
»Wat? – ne Stulle willste? – ne Backpfeife kannste krieg’n – – und dann hopps ins Bette!«
Heinrich Zille, Hans Ostwald: Das Zillebuch, 1929.
Die Männer wollen betrogen sein, und selbst wenn sie merken, daß man sich über sie lustig macht, daß man sie auslacht, sobald man von ihnen weg ist, und sie sogar mit den Zofen durchhechelt, so sind ihnen doch die erheuchelten Liebkosungen lieber als wahre ohne Brimborium.
Pietro Aretino: Die Gespräche des göttlichen Pietro Aretino, 1903
Es ist damit wie mit dem Honigkuchen der Offenbarung. Süß schmeckt er auf der Zunge, aber das Bauchgrimmen folgt hinterher.
Theodor Mügge: Der Vogt von Sylt, 1851.
Sie blieb stehen, und schließlich ließ sie verträumt und mit unendlicher Behutsamkeit ihren Finger über eine der schwarzblauen Beeren der Weintraube gehen, um zu sehen, ob der graue Hauch und Nebel, der sie bedeckte, unter dieser Berührung verschwinde oder nicht.
Paul Kornfeld: Blanche oder Das Atelier im Garten, 1957 posthum veröffentlicht.
Du tust mir ‘n büschen zu blümerant, mußt Dir wirklich erst mal den Wind um die Nase wehn lassen.
Ilse Frapan: Flügel auf! Novellen, 1895
Schon bei der Morgenandacht in der Gefängniskirche befand sich Elisa auf dem Wege durch den Blütenzauber der Landschaft, in der sie ihre ersten Schritte getan. Schon lief sie über die blühende Erde, die ganz mit Margeriten besät war. Sie sah den morgenblauen Himmel über sich, der wie von Silberfäden durchsponnen war und rings um sich die weißblühenden Büsche und Sträucher.
Edmond de Goncourt: Die Dirne Elisa, 1878.
Einmal überredete er die ganze Gesellschaft, nachts um zwölf mit ihm zum Mariensee zu marschieren und dort ein Bad zu nehmen. Übrigens paßte er dabei sorgfältig auf, daß niemand allzu erhitzt in das Wasser ging und jeder sich vor dem Hineinsteigen die Herzgrube und die Achselhöhle näßte. Er führte auch einen Budenzauber bei einem Assessor an, der zu einem Lokaltermin nach Liebstadt gefahren war. Es war der Gipfelpunkt eines Budenzaubers.
Walter Harich: Der Aufstieg, 1925 geschrieben.
Wie es höchst solide Menschen gibt, die ihren Stolz darin finden, für liederliche Schwerenöter gehalten zu werden, so gibt es auch solche, die es erfreut, wenn ihr butterweiches Gemüt nicht erkannt und sie für hart und jeder zarten Regung unzugänglich angesehen werden.
Heinrich Seidel: Die goldene Zeit , 1909.
Die Stimme war noch die alte, und in diesem Dämmerlicht erschien auch das Gesicht ganz unverändert, dies ruhige, liebe Antlitz, das in all diesen einsamen Jahren sein Leitstern gewesen war.
Alan St. Rubyn: Einer alten Jungfer Liebestraum, 1893.
Ja – und doch . . . wie ich so da eben die Dreikäsehochs mit ihren Ranzen den ersten Schulweg machen sah, zaghaft und neugierig zugleich, ängstlich und doch erwartungsvoll, das Herzchen gepfropft mit guten Vorsätzen und das Frühstück in der Tasche, da hab’ ich so bei mir gedacht: eigentlich müßt’ ich meine Mappe heut auch als Ranzen auf der Schulter tragen.
Rudolf Presber: Mein Bruder Benjamin, 1919.
Nichts, was ein Einfaltspinsel tut, kann Erstaunen oder Unwillen erregen; das Tun und Lassen eines Einfaltspinsels kann nur Verachtung einflößen.
Charles Dickens: Schwere Zeiten, 1854.
Unbegreiflich, was Sie an den Sprichwörtern haben, die doch nur Eselsbrücken, gemeine Marktplätze der Koch- und Kellerweisheit sind, bei denen sich kein Mensch von höherem Beruf aufhält, Krautkrämereien!
Johann Gottfried Herder: Adrastea, 1801-1803.
Das süddeutsche, spielerische, farbenfrohe Barock ist hier überall zu finden – es knallt mitunter vor Buntheit wie ein bunter Bauernstrauß, ist aber fast immer in künstlerischer Zucht gebändigt. Nebeneinander liegen stets der alte Fachwerkbau der Bürger, der Zünfte, der Arbeitenden – und das feierlichprunkhafte Barock der damals Herrschenden, der Bischöfe, der kleinen Fürsten.
Kurt Tucholsky, Wer kennt Odenwald und Spessart? 1925.
Vor dreiundvierzig Jahren war der Adam nach Brasilien ausgewandert, weil es ihn nicht mehr gehalten hatte in der Not der Heimat und weil ihm das Fernweh im Blut kreiste bis an sein Ende, wie es in vielen kreiste, die am Strom wohnten und die es hinaustrieb in die Länder der Erde, Gott stehe ihnen allen bei.
Roland Betsch: Ballade am Strom, 1939.
Das mag einigermaßen verrückt klingen, entschuldigen Sie, – wer aber, wie ich, sein Leben lang mit alten, greisenhaften Dingen Umgang gehabt hat, der kennt ein wenig ihre Gewohnheiten, und er bekommt ein Fingerspitzengefühl für die geheimen Anliegen und Hypochondrien solche altjüngferlicher Gegenstände.
Gustav Meyrink: Der Engel vom westlichen Fenster, 1927.
Kleine, simple Menschen sind es, die ich auf diesen Wegen finde, aber was um sie und was über ihnen ist, das sind große Dinge: der Himmel und die lebendige Natur. An diese zwei reicht kein Firlefanz moderner Welt, gegen sie ist alles von der »Kultur« Erzeugte klein und blaß.
Paul Keller: Stille Straßen, 1912.
Überall kleine Spiegel, vergoldete Amoretten, chinesisches Porzellan, ein allerliebstes Chaos von Bändern, Blumengirlanden, weißen Handschuhen, zerrissenen Blonden, falschen Perlen, Diademen von Goldblech und sonstigem Götterflitterkram, wie man dergleichen im Studierzimmer einer Primadonna zu finden pflegt.
Heinrich Heine: Florentinische Nächte, 1837.
Als er aber in dieses langweilige Kasernenhotel kommandiert wurde, und den ganzen Tag lang das Meer vor sich sah, regte sich ein gewaltiger Freiheitsdrang in ihm. Und eines Abends ging er hinunter an den Hafen, spazierte die Küste entlang, suchte sich ein arabisches Fischerboot aus, das ihm gefiel, sprengte in aller Gemütlichkeit die Kette mit einem großen Stein, zog das Segel auf und fuhr hinaus ins Meer.
Erwin Rosen: In der Fremdenlegion, 1909.
Und so stand sie da, wie eine junge *Bacchantin, welche nur auf das Zeichen harrt, um mit erglühendem Antlitz und leidenschaftlich funkelnden Augen sich in ein Meer berauschender Genüsse hinabzustürzen, Alles mit in den Freudentaumel hinein zu reißen, was nur einen Augenblick dem Zauber ihrer Erscheinung unterworfen gewesen.
Balduin Möllhausen: Der Schatz von Quivira, 1879. Eine *Bacchantin ist eine Teilnehmerin an einer Orgie des Dionysos.
Eilig trabten sie die hügeligen Straßen hinauf. Erst im Wald fühlte er sich sicher. Und dort oben, in dem jungen Frühlingserwachen, brach der Freudentaumel von neuem aus, und es war ein Jagen und Haschen, ein Kreischen und Flüstern, ein Balgen und Stilliegen. Das war das Köstlichste.
Rudolf Herzog: Die Wiskottens, 1917.
Das Sonnenlicht flirrte tanzend über die glatten Blätter. Im Grase zitterten weiße Gänseblümchen.
Oscar Wilde: Das Bildnis des Dorian Gray, 1890.
»Ich meine beides,« sagte er. »Wenn dieses unkonstitutionelle Preßgesetz Gesetz wird, so geht es der »Konstitution« (mit Gänsefüßchen) an den Kragen. Wenn es aber der »Konstitution« (mit Gänsefüßchen) an den Kragen geht, dann bleibt die Konstitution (ohne Gänsefüßchen) auf dem Papier. Darum muß, wer es mit der Konstitution (ohne Gänsefüßchen) ernst meint, dieses unkonstitutionelle Preßgesetz mit allen konstitutionellen Mitteln bekämpfen!«
Emil Ertl: Freiheit die ich meine, 1925.
Mit jener der Gedankenwelt eigenen Geschwindigkeit jagten sich in seinem Kopfe tausend reizende Bilder während der kurzen Spanne Zeit, in der er die letzten drei Stufen hinabstieg.
Theophil Gautier: Die vertauschten Paare, 1925
Im Korridor duftete es anmutig nach Kuchen, die Kaffeemaschine brodelte einladend. Der alte Hauch von Wärme und Gemütlichkeit zog durch das Schweizerhaus. Und wenn der Herbstwind an der Glasveranda rüttelte, blinkte am frühen Abend traulich das Grogglas, und der Whisttisch formierte sich.
Johann Richard zur Megede: Das Blinkfeuer von Brüsteror, 1901 – Whist ist ein englisches Kartenspiel, aus dem später Bridge hervorging.
Ich würde an Ihrer Stelle ebenfalls so’n schmutzigen Geldsack und Geizdrachen, wie Ihre zweite Hälfte, dem Habenichts von Doktor entschieden vorziehen. Sein bißchen Latein nährt ihn nicht, und wenn er seinen besten Rock in die Speisekammer hängt, ist auch noch nichts Eßbares drin. Hat der Kerl am Ende gar auf die Mitgift spekuliert?
Dietrich Theden: Menschenhasser, 1904
Nachdem ich mich ausgiebig, sehr ausgiebig gestärkt hatte, fing ich an, meine Habseligkeiten auf dem Schuppendach, das ich gerade mit den Händen erreichen konnte, aufzubauen. Zuerst die Aktentasche, dann eine Flasche nach der anderen: eine Flasche sächsischen Korn, dann vier unangebrochene und eine angebrochene Flasche Schwarzwälder Zwetschgenwasser. Alles schön ordentlich nebeneinander auf dem Dachrand.
Hans Fallada: Der Trinker, 1944
Als seine Knabenzeit zu Ende war, und er entlassen wurde, um sein Fortkommen in der Welt zu suchen, entsprach er den Erwartungen seiner Lehrmeister im Gaunertum nur schlecht. Er lungerte bald hier, bald da umher, war viel zu hasenherzig, um selbständig einen Streich auszuführen und nur darauf aus, sich Essen und Trinken zu verschaffen, ohne arbeiten zu müssen.
Julian Hawthorne: Der große Bankdiebstahl, 1888
Aber weil man so kurz lebt, wollt ich’s Leben recht genießen, und Wein und Spiel war mein Element. Das hatte mir der Höllenknecht abgemerkt und sprach zu mir in jener Nacht: So zwanzig, dreißig Jahre zu leben in diesem Kellerreich, in diesem Weinhimmel zu trinken nach Herzenslust, nicht wahr, Balthasar, das müßt’ ein Leben sein?
Wilhelm Hauff: Phantasien im Bremer Ratskeller. In: Deutscher Novellenschatz, 1910
Er war wieder geneigt, sich für ein Glückskind zu halten, wozu ihn einst die Frauen im elterlichen Hause ernannt hatten. Wurde er auch zuweilen durch Fortunas Finger herabgedrückt, immer wieder war er in die Höhe geschnellt, und er hoffte, daß die Zukunft auch seinem größten Herzenswunsch hold sein werde.
Gustav Freytag: Die Ahnen, 1872
Ein Frühlingstag in Blütenschnee. So recht ein Tag, wo alles, was jung ist, ins Himmelsblau und Waldesduften hinausjauchzen möchte.
Wilhelm Wiesebach: Er und Ich, 1916
Ottilie, wie schon erwaͤhnt, schien mit ihren Gedanken am blauen Himmelszelte zu weilen, unter welchem verspätete Schwalben hin und her schwebten.
Karl von Holtei: Die Vagabunden, 1852
Die goldenen Sterne grüßen
So klein vom Himmelszelt,
Es geht ein Wehn und Küssen
Heimlich durch alle Welt.
Die Blumen selber neigen
Sehnsüchtig einander sich zu …
Emanuel Geibel, 1815-1884
“Kommt wohl ein Geist in diese Tiefe nimmer
Vom ersten Grad, wo nichts zur Qual gereicht,
Als daß erstorben jeder Hoffnungsschimmer?”
Dante Alighieri: Die Göttliche Komödie, 1307-1321
Faust öffnete den Kasten, und warf einen schweren Sack voll Gold auf den Tisch. Da er den Sack aufmachte, und das Gold schimmerte, verbreitete sich Heiterkeit auf die traurigen Gesichter. Hierauf zog er schöne Kleider und Kleinodien aus dem Kasten, und übergab sie seinem Weibe. Die Tränen verschwanden, die Eitelkeit leckte sie weg, wie die Sonnenhitze den Tau, und Munterkeit goß sich über das Angesicht des jungen Weibs.
Friedrich Maximilian Klinger: Faust’s Leben, Taten und Höllenfahrt, 1791
Zwischen deinen Mappen hast du gehockt, in deine Bücher hast du dich gewühlt, in nichts wie in deinen ganzen, alten, albernen, übergefahrnen, schnurrpfeiferischen Krimskrams warst du verdöst! Nichts, nichts, nichts, was nicht ödester, blödester, hirnverbranntester, hirnverbrühtester, hirnverrammeltster Selbstbetrug war! Und jetzt? Jetzt bist du fertig!
Arno Holz: Sonnenfinsternis, 1908
Es hatte sich nämlich um den Einsamen und Nachdenksamen, der allmählich, wie man zu sagen pflegt, jetzt auch in die gestandenen Jahre kam, der sogenannte Kummerspeck angesetzt, so daß der Stil seines leiblichen Wesens sich änderte und die hagere, gothische Spitzbogigkeit sich zu romanischen Rundbögen freundlich zu wölben begann.
Paul Wertheimer: Respektlose Geschichten, 1929
Ein stärkend Labsal, edler Buckingham,
Ist meinem kranken Herzen dies dein Wort.
William Shakespeare: Richard III, 1633
Es ist nicht recht, daß sie ein solches Wort zu mir sagt; frech ist sie und lausbübisch, ich hätte Lust, sie an den Haaren zu ziehen, die appetitliche Schlampe. Sie lacht und kriegt Falten in die Nase.
Roland Betsch: Die Verzauberten, 1934
Von heißer Lebenslust entglüht,
Hab ich das Sommerland durchstreift;
Drob ist der Tag schön abgeblüht
Und zu der schönsten Nacht gereift.
Gottfried Keller: Siebenundzwanzig Liebeslieder, 1846
Wie süß ist es doch in solchem Augenblick, sich der eigenen Schönheit bewußt zu werden und die Liebe durch den bewundernden Stolz noch zu steigern. In ihrer Robe, die wie aus Blütenblättern angefertigt schien und von einem Tüllüberwurf, zarter und durchsichtiger als ein Libellenflügel, teilweise bedeckt war, und den verstreute Erikablüten da und dort festhielten, glich sie einer Sylphide, der die Laune angekommen, einen Ball zu besuchen.
Théophile Gautier: Die vertauschten Paare, 1925
Im zweiten Akt der ›Wildente‹ sitzt die Ekdalsche Familie am Tisch, Mann, Frau, Tochter, und die Frau rechnet eben ihr Wirtschaftsbuch zusammen: ›Brot 15, Speck. 30, Käse 10 -ja -‘s geht auf‹, und dabei, brennt die kleine Lampe mit dem grünen Deckelschirm, und die Luft ist schwül, und das arme Kinderherz sehnt sich nach einem Lichtblick des Lebens, nach Lachen und Liebe.
Kurt Tucholsky: Der alte Fontane, 1919
Am nächsten Abend ging er mit ihr auf ein paar Minuten vor Abgang seines Zuges ins Lichtspielhaus. Während sie dasaßen, sah er ihre Hand dicht neben sich liegen. Ein paar Augenblicke wagte er nicht, sie zu berühren. Die Bilder tanzten und flimmerten.
David Herbert Lawrence: Söhne und Liebhaber. Zweiter Teil, 1925
Unter allen Kunstgriffen deren die Welt sich zu ihren Zwecken bedient, ist die Lobhudelei gewiß der schädlichste. In Paris hauptsächlich geht man eigentlich darauf aus, ein keimendes Talent schon bei seiner Geburt unter den Kränzen, die Wiege wirft zu ersticken.
Honoré de Balzac: Der Dorfarzt, 1835
Anonyme Briefe kamen, daß der junge Herr bereits anderweitig engagirt sei und nur das Vermögen Juliens erobern wolle; Warnungen kamen, daß er ein Luftikus sei und von seinem Fache eigentlich gar nichts verstehe, daß sein eigener Vater sich von ihm losgesagt habe, weil er schon Unsummen am grünen Tische durchgebracht habe und tief in Schulden stecke — kurz, die ganze Litanei des Neides, der Bosheit, der Verleumdung aller Art.
Julius Grosse: Vetter Isidor. In: Deutscher Novellenschatz, 1910
Zu anderen Zeiten aber, wenn trüber Mißmut auf der Höhle brütete, und jeder auf seinem Instrument klagte, dann wurde er traurig und litt mit ihnen und saß mit gefalteten Händen dabei und dachte an die böse Welt und den Schiffbruch seines eigenen privaten Glücks. Eine Bauerntochter seines Heimatdorfes hatte ihn einst mit einem Luftikus aus der Stadt betrogen.
Laurids Bruun: Van Zantens Insel der Verheißung, 1933
So schimmernd sinken die Freuden des Menschen vom Himmel und zerfließen schon unter dem Sinken! So rinnt alles dahin! Ach welche Luftschlösser sah ich von dieser Höhe um mich glänzen, und Abendrot glimmte an ihnen! Ach alle sind unter Schnee verschüttet und unter Nacht!
Jean Paul Richter: Hesperus: 45 Hundsposttage – Eine Lebensbeschreibung, 1864
Der Tag verglomm, die Lichter flammten auf, und staunend stand vor ihrem Spiegelbild ein herrlich Weib; verzückt sah es sich an und lächelte … und nickte still sich zu, wie in Bewundrung ihrer Schönheitsmacht. Von dem gardenienschlanken Frauenleib fiel knisternd weißer Sammet und Seidenstoff und Silbergaze märchenhaft herab, und in dem vollen, hochgetürmten Haar erzitterte mit jedem einzgen Schritt ein Falter, von Demanten übersät.
Else Galen-Gube (1869 – 1922): Aus dem Leben und den Träumen eines Weibes, 1905
Alles ist göttliches Geschenk. Warum ist der eine hübsch und der andere häßlich? Und nun gar erst die Damen. In das eine Fräulein verliebt sich alles, und das andre spielt bloß Mauerblümchen.
Theodor Fontane: Der Stechlin, 1899
»Oho, Kind, du sprichst da wie der Blinde von der Farbe!« lachte die Hofrätin. »Närrchen, was weißt denn du von Herzenskämpfen! Hast ja noch einen Puppenspielwinkel in deiner Stube! Übrigens, Gott mag dich behüten, daß dir niemals dergleichen Kämpfe nahe treten,« fügte sie weich hinzu und strich liebkosend über das reiche Haar des jungen Mädchens, »es sähe dann doch wohl übel aus um meine kleine Mondscheinprinzessin!«
Eugenie Marlitt: Thüringer Erzählungen
Es ist mehr, es ist ein wunderlich Wesen, diese Amelie. Wenn man noch keinen Begriff von einer Mondscheinprinzessin hat, so muß man sie ansehen, aber feineren, durchsichtigeren Teint habe ich nie erblickt, weicheres, schöneres Organ nie gehört – ich kann mich nur von dem Gedanken nicht losmachen, daß all solche toll romantische Personen schwachköpfig sind.
Heinrich Laube: Das junge Europa, Leipzig 1908
Ich machte den Mondscheingang, den die wundervolle Hexe leider oder auch vielleicht glücklicherweise anzutreten nicht im Stande war — weil — sie ihre Gäste anzulächeln hatte.
Wilhelm Raabe; Meister Autor, oder, die Geschichten vom versunkenen Garten, 1873
Morgentau ist gut für abgehauene Füße«, rief sie und flog fort, brachte davon und bestrich ihn; gleich waren seine Füße frisch und gesund. Die Jungfrau war wieder fort. Nun trat er auf die silberne Birne, die war auch aus seiner Tasche herausgefallen und drehte sich.
Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen, Josef Haltrich, 2014.
Da zogen sie ihre Schleier vors Gesicht und hielten sich die Hände vor den Mund und gingen auf Zehenspitzen mucksmäuschenstill in den Palast zurück.
Rudyard Kipling: Nur-so-Geschichten, 1902
Sein Kopf war eine gute Requisitenkammer; aller Mummenschanz der Historie lag da hübsch aufgestapelt, schön geordnet nach Völkern und Jahrhunderten. Die Rollen waren verteilt, und er würde seine Puppen anziehen, so bunt und wild, würde einen Fasching machen, wie die Welt noch keinen gesehen.
Hanns Heinz Ewers: Der Zauberlehrling oder die Teufelsjäger, 1917
Ihr seht schon, in Utopien gibt es nirgends eine Möglichkeit zum Müßiggang oder einen Vorwand zur Trägheit. Keine Weinschenken, keine Bierhäuser, nirgends ein Bordell, keine Gelegenheit zur Verführung, keine Schlupfwinkel, keine Stätten der Liederlichkeit; jeder ist vielmehr den Blicken der Allgemeinheit ausgesetzt, die ihn entweder zur gewohnten Arbeit zwingt oder ihm nur ein ehrbares Vergnügen gestattet.
Thomas Morus: Utopia, 1516
Wer mag wohl überhaupt jetzt eine Schrift
Von mäßig klugem Inhalt lesen!
Und was das liebe junge Volk betrifft,
Das ist noch nie so naseweis gewesen.
Johann Wolfgang von Goethe: Faust: Eine Tragödie, 1808
Oh, da wollte Frau Fink wohl schon selber acht haben, dass ihrem kranken Kinde nichts Böses geschah. Sie flog von der Linde zu dem Fliederbusch und sang ihr Nesthäkchen in den Schlaf. Nach ein paar Tagen war der verletzte Flügel wieder zusammengeheilt. Wirklich, der alte Vogeldoktor war zu empfehlen.
Nesthäkchen im weißen Haar: Band 10, Else Ury, 1925
Sage mir zuerst, wo du deinen gesunden Appetit gelassen hast, das übrige wird sich schon finden. Denn wenn ein kräftiger Mensch von deinen Jahren, der sich bei Tage müde und matt gearbeitet hat, abends nicht ißt und trinkt und immer wie eine stumme Pagode dasitzt, so ist es entweder im Oberstübchen oder in der Herzkammer nicht richtig, und ich möchte es gern wissen, wo es bei dir sitzt.
Philipp Galen: Der Strandvogt von Jasmund, 1807 bis 1813
Was hör’ ich? Welch ein Ton! welch liebliches Organ!
Die Stimme klingt so voll ans volle Herz heran!
Mit welcher Leichtigkeit vermählt sich Wort und Klang!
Ein wahrer Ohrenschmaus! Das nenn’ ich doch Gesang!
Theodor Körner: Die Braut (Lustspiel), 1811
Meine Stimmung wechselt. Bald möchte ich Purzelbaum schlagen, bald alle Welt umarmen, wobei ich dann doch meist aus Ermangelung an besserem Material nach Willi greife! Bald möchte ich vor Übermut die Sonne ausblasen, und dann wieder vor Wonne weinen!
Margarete Michaelson (Ernst Georgy): Die Berliner Range Band 10 – Lotte Bach’s Hochzeitsreise, 1901
Herwarth, Du mußt auch flüstern lernen, man hört das Echo der Welt ganz deutlich. Wenn der Bischof und ich flüstern, werden die Wände leise und die Möbel erträglich, ihre Farben mild. Und die Spiegel der Schränke sind Bäche, und unsere Liebe ist ein Heimchen oder eine Grille, eine Pusteblume, daraus sich die Kinder Ketten machen.
Else Lasker-Schüler: Mein Herz – Ein Liebesroman mit Bildern und wirklich lebenden Menschen, 1912
Er dachte nicht daran, dass er sich notwendig rüsten müsse, bis er nach Lichtern verlangen musste, und das Rasseln der Wagenräder und das Stampfen von Pferden hörte. Jetzt eilte er, seine Saumseligkeit gut zu machen; aber Jerome war nicht so flink und eifrig wie gewöhnlich.
Der Hugenotte Teil 2, George Payne Rainsford James, 1839
Herr Jakob Muffel war nach einem kräftigen Schlummertrunk behaglich zu Bett gegangen und träumte recht angenehm von der jungen, zarten Barbara Nützelin, die über zwei Wochen an seiner Seite liegen sollte.
Karl Bröger: Das Buch vom Eppele, 1926
Vielleicht ists sehr ungezogen, der Sektlaune einer drallen Dirne den Schmerz einer hehren Muse zu vergleichen. Aber ist die Theatermuse von heutzutage wirklich so hehr?
Die Zukunft (Zeitschrift), 1894
Sommerfrische! Der schönste, berückendste, entzückendste Begriff der Welt! Fern den heißen, engen Straßen der Großstadt mit den himmelanstrebenden Häusern; fern dem Staub, dem gräulichen, unausstehlichen, der in leichter Schicht auf dem Trottoir und dem asphaltierten Fahrdamm liegt, der von jedem Kleide aufgewirbelt wird, unter jedem Hufschlage aufquillt und hinter den rollenden Wagen in dunstigen, die Kehle schnürenden Wolken herzieht.
Dietrich Theden: Ein Verteidiger, 1900
Er stellte sich vor den Spiegel und schloß die Augen. Er öffnete sie erst wieder, nachdem ein paar Minuten vergangen waren, und erwartete dann, daß es vorübergegangen sei. Aber das war es nicht; er war und blieb gleich klein. Sonst glich er sich selbst, er war ganz so wie früher. Das flachsgelbe Haar und die Sommersprossen über der Nase und die Flicken an der Hose und die Stopfstelle an dem Strumpf, das war alles genau so, wie es zu sein pflegte, nur daß alles kleiner geworden war.
Selma Lagerlöf: Niels Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, 1906
Ich drohe ihr, sie lacht mich an,
Wie nur ein Mädel lachen kann,
Spitzbübisch, schelmisch und doch ganz lieb.
Es ist ein allerliebster Dieb,
Und da – ich will recht finster blicken
Und kann nur lachen und freundlich nicken.
Gustav Falke: Hohe Sommertage (Neue Gedichte), 1902
Jetzt ertönten Schritte auf dem Fußsteige draußen, der an dem pastorlichen Gartenzaune vorbeiführte; junge Mädchen mußten es sein, sie schwatzten und kicherten. Nicht lange darauf kam ein Troß Burschen lachend und lärmend desselben Weges. Gerland wußte, wo sie sich hinbegaben. Der Weg führte auf eine bewaldete Kuppe hinter dem Dorfe, welche Gemeindeeigentum war. Dieses Büschchen bildete ein beliebtes Stelldichein für die Jugend des Ortes. Jeden Sonntag, im Laufe des Sommers, sah er die Jünglinge und Jungfrauen von Breitendorf gegen Abend dort hinausziehen.
Wilhelm von Polenz: Der Pfarrer von Breitendorf, 1893
Vielleicht sind Sie nur eine Sternschnuppe. Sie glänzen auf, ziehen Ihre schmale goldene Bahn, ein, zwei, drei Sekunden, und erlöschen im Dunkeln wie ein Lampion, der beim Frühlingsfest ins Wasser fällt.
Klabund: Der Kreidekreis, 1925
Die frohen Ausflügler wanderten durch das Dorf und standen vor dem lieblichsten von allen Höfen in beschaulicher Betrachtung still. An den flüsternden Bach schmiegte sich ein smaragdener Wiesenstreif, auf dem weiße Enten sich sonnten und flaumgelbe »Göffel« schwerfällig watschelnd die Grashalme gierig rupften. Über den grünen Grund hingen die baumhohen Syringen des Gartens, der ein Tausendschön von allen Farben, von Dornrot, Goldregen und schneeweißen Blüten war. Vom dichten Blatt- und Blütenhag auf drei Seiten umhegt, lugte ein hellgetünchtes, strohgedecktes Haus mit seinen zwei Scheunen hervor.
Johannes Dose: Der Muttersohn – Band II, 1906. Syringe = Flieder
Da ist ein junger Tunichtgut, der nicht weiß, was er mit sich anfangen will. Und die anderen wissen es auch nicht, wie sehr sie ihm auch ins Gewissen geredet haben.
Rund um die Erde: Irrfahrten und Abenteuer eines Grünhorns, Kurt Faber, 1906
Der Himmel glühte wunderbar in Purpur und Gold, bis allgemach dieser Glanz verlöschte und die Himmelsluft, die erst einem Beet von Vergißmeinicht geglichen, jetzt in ein Feld dunkler Kornblumen sich umdunkelte.
Otto-Peters, Louise: Ein Bauernsohn. Leipzig, 1849
Am Himmel steht der gleißend klare Vollmond. Zwischen weithingestreckten, sehr seinen Flockenwölkchen, die, von einem bernsteingelben Hauch durchtrankt, wie sehr hohe, himmlische Krokusbeete sind. Darunter hin jagen durch ein unsäglich reines Blau mit silberweißen Rändern wunderliche Gestalten mächtiger, dunkler Wolkenungetüme.
Johannes Schlaf: Neue Erzählungen aus Dingsda, 1924
Aus der Heimat hinter den Blitzen rot
Da kommen die Wolken her,
Aber Vater und Mutter sind lange tot,
Es kennt mich dort keiner mehr.Wie bald, ach wie bald kommt die stille Zeit,
Da ruhe ich auch, und über mir
Rauscht die schöne Waldeinsamkeit,
Und keiner kennt mich mehr hier.
Joseph von Eichendorff: In der Fremde (Gedichte), 1841
Wie ist’s so schön, so wonnevoll da oben! Ein Hügel ragt in sonnenklarer Luft. Hier braust kein Sturm und keine Wellen toben; nur Rosen blüh’n mit heimatlichem Duft. Und rechts und links auf langverlornen Spuren schlingt sich ein Pfad hinauf nach Edens Fluren.
Die Erlösung, Wilhelm Bauberger, 1841.
Herbstferien! Mein Uwe und ich hatten uns mehr darauf gefreut, als alle Schulkinder zusammengenommen. Denn wir wollten wandern! In trauter Zweisamkeit durch unsere geliebte Heide, immer weiter, immer weiter, bis irgendwo ein strohumdecktes Hüttchen winkte, darin zwei selige Menschenkinder Obdach fänden bis zum andern Tag, um dann mit frischen Kräften weiter zu wandern.
Felicitas Rose: Heideschulmeister Uwe Karsten, 1909
Einige Begriffe wie Bauchgefühl, Blickfang, Knalltüte, Luftschlange, Heimeligkeit und Bauchpinseln stammen aus neuerer Zeit, hier gibt es kein klassisches Zitat.
Werkstattbericht
Das Beitragsbild ist eine Komposition aus zwei Motiven, die aus dem Fundus von Pixabay stammen: #1, #2. Die verwendeten Google Fonts sind BenchNine und PT Sans. Recherche via Google, Google Books und im Projekt Gutenberg.