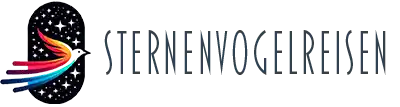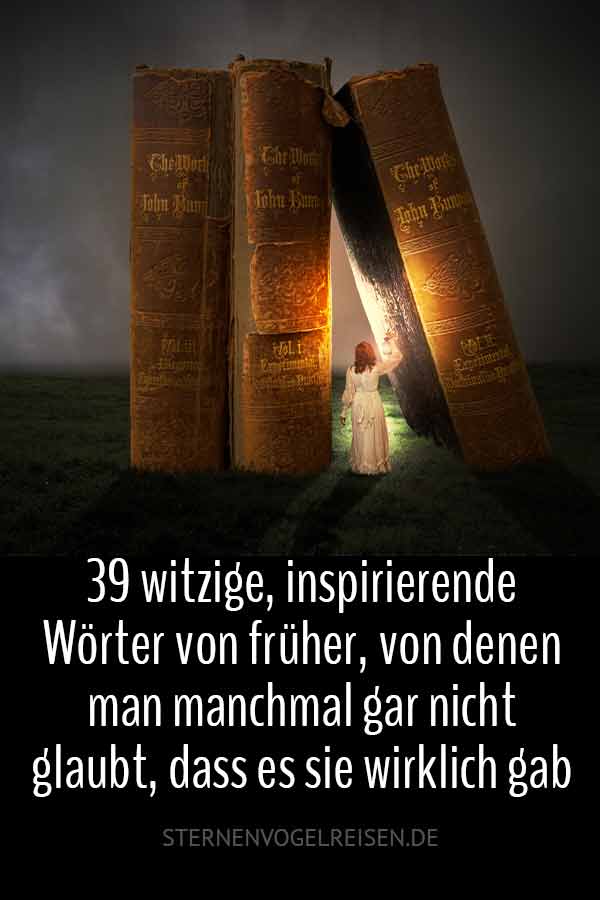
Beinahe wie ausgedacht klingen diese Wörter. Aber das sind sie nicht. Hier ist alles echt. Seltsam, interessant, ungewöhnlich, vielleicht weiß man auf den ersten Blick nicht, was gemeint ist. Aber auf den zweiten, da kriegt man es oft heraus.
Die deutsche Sprache überrascht einmal mehr und erfreut uns mit ihrer Vielfalt und Originalität. Denn die deutsche Sprache, reich und vielschichtig, birgt in ihren Tiefen Wörter und Ausdrücke, die wie verlorene Schätze darauf warten, wiederentdeckt zu werden.
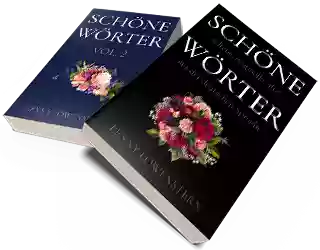 Eine Bibliothek der schönen Wörter ... Ja, es gibt sie noch, die schönen Wörter. Begriffe mit dem besonderen Klang. Wörter, die Sehnsüchte und Erinnerungen in uns hervorrufen. Die Welt von damals, sie ist noch vorhanden. Erinnerungen an Altes und längst Vergessenes. Was verloren ging, ging nie ganz, die Sprache bewahrt es für uns. Hier ist eine wunderfrohe Blütenlese in Buchform mit den schönsten Wörtern der deutschen Sprache. Jetzt ansehen
Eine Bibliothek der schönen Wörter ... Ja, es gibt sie noch, die schönen Wörter. Begriffe mit dem besonderen Klang. Wörter, die Sehnsüchte und Erinnerungen in uns hervorrufen. Die Welt von damals, sie ist noch vorhanden. Erinnerungen an Altes und längst Vergessenes. Was verloren ging, ging nie ganz, die Sprache bewahrt es für uns. Hier ist eine wunderfrohe Blütenlese in Buchform mit den schönsten Wörtern der deutschen Sprache. Jetzt ansehenEinige dieser Worte sind poetisch, andere nostalgisch, und wieder andere verblüffen durch ihre Präzision. In einer Zeit der Schnelllebigkeit und Digitalisierung neigen wir dazu, viele dieser sprachlichen Perlen zu übersehen.
Hier ist die pure Magie in Wörtern, die zu schade sind, um in Vergessenheit zu geraten. Siehe auch:
- 79 schöne vergessene Wörter von Früher … mit Erläuterungen
- Wohlfühlwörter in Zitaten aus der Literatur
- Wörter selbst ausdenken … Begriffe, die es (noch) gar nicht gibt
Liste mit witzigen, inspirierenden Wörtern von früher
Alphabetisch sortiert. Ich wünsche ein spannendes Entdeckungsvergnügen.
- aufschnüpfisch (unverschämt)
- Augenfrage (gemeint ist nicht eine medizinische Frage, die man einem Arzt stellt, sondern ein fragender Wink, dem man mit dem Auge gibt)
- Augenschießer (Libelle, weil sie mitunter schnell und unvorhersehbar auf einen zuschießt)
- augensüß (adj.) (ein lieblicher Anblick für das Auge)
- Augentauwetter (das Weinen)
- beschwappeln (sich besaufen und befressen)
- Bienensorgen (kleine Sorgen, der Begriff wurde von Schiller benutzt)
- Brausebeutel (Scheltwort für einen leichtsinnigen, brausender, windigen Menschen)
- Brausejahre (die brausend wilde Jugendzeit)
- Brunnenbelustigung (Landpartie, Ausflug aufs Land)
- Buchfell (Pergament, weil es aus Häuten hergestellt wurde)
- bübischmädchenhaft (adj.) (ungeschlechtlich, androgyn; auch mädchenbubenhaft, findet sich bei Goethe)
- Donnerhagelsjunge, Donnerhagelskerl (für eine Person, die als besonders kräftig, ungestüm oder draufgängerisch galt)
- Donnerwettermännchen (jemand, der sich künstlich aufbläst – nach Jean Paul Richter)
- Dreigroschenplatz (der billigste Platz im Theater)
- Dreihaar (ein durchtriebener Kerl, dem von allem Raufen und Schlagen nur wenig Haare übrig geblieben sind)
- Dreihaarsamthose (eine abgetragene, fadenscheinige Hose)
- Dunstkind (Irrwisch)
- Duttenluller (ein Kind, das immer an der Brust liegen will)
- Eselsstück (dummener Streich)
- Eselstanz (tölpelhafter Tanz)
- Fackelauge (leuchtendes, funkelndes Auge)
- Fatzwörter (Gespött; eine Fatzerei das sind Possen, Narrenpossen)
- Fatzvogel (Spaßvogel, Spottvogel)
- Federallee (sich in die Federallee begeben, in die Federallee marschieren)
- Friedefeuer (Elmsfeuer)
- Furienauge (wildrollendes, wutfunkelndes Auge, wie das einer Furie)
- Gassenschwärmer (Nachtschwärmer, nachts durch die Gassen ziehen)
- geschleckig (adj.) (leckerhaft, naschhaft)
- Geschmeideschränkchen (kleiner Schrank für Schmuck)
- geschmucklicht (adj.) (gefällig, zierlich)
- geschnäppig, geschnäppisch (adj.) (vorlaut, naseweis, schnippisch)
- Giftbläser (schlimmer Berater, gibt schlechten Rat)
- Gutgönner (einer, der andere unterstützt)
- Hengstkerl (famoser Typ)
- Hosenjauchzer, Hosenseufzer (Flatulenz, Furz)
- hummelwitzig (adj.) (verrückte Gedanken haben)
- Königleinhaar (Kaninchenhaar)
- Lappenpuppe (aus Lappen zusammengeflickte Puppe)
- Lappenspieler (einer, der Gaukeleien trieb)
- Liliennase (blendend weisse Nase)
- Mäusegeschäft (kleines Geschäft, unbedeutende Handlung)
- Narrenzeitvertreib (sinnlose Zerstreuung)
- Nasenbrenner (kurze Tabakpfeife)
- Neinsilbigkeit (das Schweigen als Steigerung zur Einsilbigkeit, nach Jean Paul Richter)
- Neunundneunziger (so nannte man früher die Apotheker, weil man meinte, dass diese an allem 99% verdienten)
- Schelmenzunftberater (Leuteverführer)
- Schweinsfedern (scherzhaft für das Stroh, wenn man darin liegt)
- Sonnenkäferleben (gutes, unbeschwertes Leben)
- Spazierfreude (Spazierlust)
- Spazierhölzer (gemeint sind die Beine)
- Strangschläger (jemand, der über die Stränge schlägt; ein junger, mutwilliger Mensch, der wie ein junges wildes Pferd über den Strang schlägt)
- Stubenstänkerlein (Schoßhund)
- Stutenwoche (steht für eine angenehme Zeit, zum Beispiel die erste Schulwoche, in der die Kinder noch geschont werden)
- Vollkommenheitsträumer
- Windpoet (Dichterling, ein schwacher möchtergern Dichter)
- Wirrmacher (einer, der Verwirrung stiftet)
- Zweigroschenbude (Bude, in der Dinge für zwei Groschen verkauft wurden, wäre heute vielleicht die Eineurobude)
- Zwietrachtsfunken (Ausgangspunkt von Mißtrauen)
Inspirierende Wörter in alter Literatur
Der war zufrieden, packte den schweren Goldklumpen in ein Tüchlein und machte sich auf die Spazierhölzer. Das Gehen wurde ihm aber blutsauer, er schwitzte, daß er troff, denn der Goldklumpen war schrecklich schwer, er mochte ihn tragen wie er wollte, auf dem Kopf oder auf den Schultern.
Ludwig Bechstein: Deutsches Märchenbuch. Hans im Glücke, 1845
Unter allen dortigen Freunden meines Herrn zeichnete sich vorzüglich ein Apotheker aus, der kürzlich aus Rußland gekommen und eben derselbe war, zu welchem, als er noch in Petersburg wohnte, ein Mann reisete, um mit ihm den Betrug zu verabreden, durch den er und seine Gesellen sich hernach für gewisse geistliche Personen ausgaben – Doch das gehört nicht hierher. Peter Claus mag niemand öffentlich beschämen, obgleich ihm manches Anekdötchen von der Art bekannt ist, womit man Menschen entzaubern könnte. Genug! Dieser Neunundneunziger war ein durchtriebner Schalk, bei den Jesuiten erzogen, von ihnen geleitet, ein würdiger Schüler würdiger Lehrer.
Adolph Freiherr Knigge: Geschichte Peter Clausens, 1783
Dafür aber fand ich Gelegenheit, am Ende doch ein Stückchen Freundschaft zu schließen mit dem häßlichen Giftbläser; denn das muß ich nun sagen, dumm ist der Mensch nicht und langweilig auch nicht, sondern was er sagte, gab mir entweder etwas zu lachen oder etwas zu denken, wenn es auch noch so wunderlich und böse klang.
Hans Hoffmann: Der eiserne Rittmeister, 1890
Werkstattbericht
Das Beitragsbild stammt aus dem Fundus von Pixabay. Die verwendeten Google Fonts sind BenchNine und PT Sans. Recherche via Google und im Deutschen Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm.